Worum es hier geht:
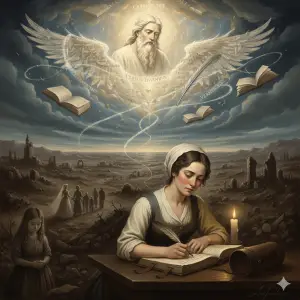
Das Bild zeigt eine dichtende Frau vor dem Hintergrund einer traurigen Vergangenheit, aber mit einem inneren Blick nach oben, zum Himmel, aus dem sie glaubt, ihre Poesie schöpfen zu können.
- Präsentiert wird ein Gedicht von Anna Louisa Karsch (1722–1791), einer der wenigen Frauen, die im 18. Jhdt. schon Gedichte veröffentlichen konnten und auch ziemlich anerkannt waren. Sie wurde sogar mit der berühmten altgriechischen Dichterin Sappho verglichen.
- In ihrem Gedicht „An den Domherrn von Rochow“ reagiert sie auf eine Bemerkung, die ihr Talent auf die Wirkung der Liebe zurückführt – und kontert sie mit einer selbstbewussten, poetisch wie gedanklich starken Gegenrede. Das ist nicht nur ein Stück Autobiografie, sondern es spricht auch ein wichtiges Thema an: Muss man das alles selbst erlebt haben, was man „erdichtet“?
- Außerdem enthält das Gedicht Kennzeichen der Aufklärung, aber auch schon der Sturm-und-Drang-Zeit.
Zunächst der Text
Anna Louisa Karsch
An den Domherrn von Rochow,
als er gesagt hatte,
die Liebe müsse sie gelehret haben,
so schöne Verse zu machen
- Kenner von dem sapphischen Gesange!
- Unter Deinem weißen Überhange
- Klopft ein Herze, voller Glut in Dir!
- Von der Liebe ward es unterrichtet,
- Dieses Herze, aber ganz erdichtet
- Nennst Du sie die Lehrerin von mir!
- Aufnahme der im Titel angedeuteten Behauptung des Domherrn, die Dichterin müsste viel Erfahrung in der Liebe haben, um solche Gedichte schreiben zu können.
- Ohne Regung, die ich oft beschreibe,
- Ohne Zärtlichkeit ward ich zum Weibe,
- Ward zur Mutter! wie im wilden Krieg,
- Unverliebt ein Mädchen werden müßte,
- Die ein Krieger halb gezwungen küsste,
- Der die Mauer einer Stadt erstieg.
- Sie beschreibt ihre Entwicklung, die keine echte Liebe kannte, sondern wohl eher in einer typischen Zwangsehe der Zeit lebte.
- Meine Jugend ward gedrückt von Sorgen,
- Seufzend sang an manchem Sommermorgen
- Meine Einfalt ihr gestammelt Lief
- Nicht dem Jüngling töneten Gesänge,
- Nein, dem Gott, der auf der Menschen Menge
- Wie auf Ameishaufen niedersieht!
- Bekenntnis, dass die Gefühle in ihren Gedichten sich eher auf Gott richteten als auf einen konkreten Menschen.
- Das erinnert an Nonnen in früheren Zeiten, die sich auch in einer Art Ehe mit Jesus Christus aufgehoben fühlten („Braut Christi“)
http://www.zeno.org/nid/20005134544
1. Einleitung: Verfasser, Titel, Textsorte, Thema
Das Gedicht „An den Domherrn von Rochow“ stammt von der deutschen Dichterin Anna Louisa Karsch (1722–1791). Sie gilt als bedeutende Vertreterin der Empfindsamkeit und wird oft als eine der ersten bekannten „Autodidaktinnen“ der deutschen Literatur bezeichnet, die ohne formale Bildung zu literarischem Ruhm gelangte. Sie wurde von Zeitgenossen auch als „deutsche Sappho“ bezeichnet.
Es handelt sich um ein lyrisches Ich-Gedicht, das in direkter Anrede an einen realen Adressaten – den Domherrn von Rochow – gerichtet ist. Thema ist die Auseinandersetzung mit der eigenen dichterischen Inspiration und dem Vorwurf, ihre Poesie sei allein durch Liebeserfahrung geprägt.
2. Äußere Form: Strophen, Reim, Metrum
Das Gedicht besteht aus drei Strophen mit jeweils sechs Versen. Die Reimform ist unregelmäßig, folgt aber im ersten Abschnitt einer Paarreimform mit Umstellungen:
- 5-hebiger Trochäus
- Reimschema: aabccb
3. Inhaltliche Erschließung: Aussagen des lyrischen Ichs
Strophe 1 (Z. 1–6):
Das lyrische Ich spricht den Domherrn direkt an, nennt ihn „Kenner von dem sapphischen Gesange“ – eine Anspielung auf die Dichterin Sappho. Es wird seine Aussage zitiert, dass „die Liebe“ die Lehrerin der Dichtung der Sprecherin sei. Diese Zuschreibung wird jedoch kritisch infrage gestellt:
-
Das Herz des Domherrn sei selbst voll „Glut“, also leidenschaftlich.
-
Er selbst sei wohl „von der Liebe unterrichtet“ worden – warum also sollte ausgerechnet sie nur durch Liebe zur Dichtkunst gefunden haben?
➡ Zwischenfazit: Das lyrische Ich wehrt sich gegen die Reduktion ihrer Dichtkunst auf bloße Liebeserfahrung. Der Leser gewinnt den Eindruck einer selbstbewussten Frau, die sich gegen gängige Zuschreibungen wehrt.
Strophe 2 (Z. 7–12):
Die Sprecherin schildert, dass sie keine Zärtlichkeit erfahren habe, sondern unter schwierigen Umständen zur Frau und Mutter geworden sei:
-
„Ohne Regung“, „ohne Zärtlichkeit“ – keine Liebeserfahrung!
-
Die Beschreibung eines Übergriffs: eine fast gewaltsame, kriegsartige Zeugungssituation („wie im wilden Krieg“).
➡ Zwischenfazit: Hier wird deutlich, dass das lyrische Ich keine idealisierte Liebeserfahrung kennt. Vielmehr zeichnet sich ein düsteres Bild einer Frau, die ohne romantische Liebe leben musste. Das klagt gängige Rollenbilder an.
Strophe 3 (Z. 13–18):
Die Jugend der Sprecherin sei von Sorgen überschattet gewesen. Sie habe zwar gedichtet, aber nicht für einen Geliebten, sondern für Gott:
-
Ihre „Einfalt“ sang „seufzend“ an „manchem Sommermorgen“.
-
Ihr Blick galt nicht dem „Jüngling“, sondern einem distanzierten, fast gleichgültigen Gott, der „wie auf Ameishaufen niedersieht“.
➡ Zwischenfazit: Die Dichtung des lyrischen Ichs speist sich nicht aus romantischer Liebe, sondern aus Leid, Einsamkeit und spiritueller Suche. Der Blick Gottes ist kühl und distanziert – eine Kritik an einer Weltordnung ohne Mitgefühl?
4. Zentrale Aussagen des Gedichts
Das Gedicht macht deutlich:
-
Dichtung entsteht nicht zwingend aus Liebe, sondern auch aus Leid, Not und innerer Bewegung (Z. 13–15).
-
Die Zuschreibung, eine Frau müsse aus Liebeserfahrung schreiben, wird kritisiert und zurückgewiesen (Z. 6).
-
Das Gedicht zeigt eine weibliche Stimme, die selbstbewusst ihre Lebenserfahrung gegen männliche Deutungsmuster stellt.
5. Sprachliche und rhetorische Mittel
-
Direkte Anrede (Apostrophe): „Kenner von dem sapphischen Gesange!“ (Z. 1) – hebt den persönlichen Charakter hervor.
-
Ironie / Kontrast: Das Herz des Domherrn sei „voller Glut“, obwohl er sie belehrt (Z. 3–4).
-
Metaphern: „Der die Mauer einer Stadt erstieg“ (Z. 11) – drastische Darstellung sexueller Gewalt.
-
Vergleiche: „Wie im wilden Krieg“ (Z. 10) – intensiver Ausdruck des Unromantischen.
-
Alliteration und Klang: „Seufzend sang an manchem Sommermorgen“ (Z. 13) – klangliche Verdichtung von Leid und Wiederholung.
-
Hyperbel: „Wie auf Ameishaufen niedersieht“ (Z. 18) – Entfremdung vom göttlichen Blick.
➡ Diese Mittel stützen die Hauptaussage, dass die Quelle der Dichtung in tiefer persönlicher Erfahrung und Leidensgeschichte liegt – nicht in einer idealisierten Liebeserfahrung.
6. Was kann man mit diesem Gedicht anfangen?
Das Gedicht eröffnet einen spannenden Einblick in die weibliche Perspektive des 18. Jahrhunderts, besonders im Hinblick auf:
-
den Kampf um Anerkennung als Dichterin,
-
die Ablehnung männlicher Zuschreibungen,
-
das Sprechen über Gewalt und Entbehrung, ohne sich zu stilisieren.
Es eignet sich hervorragend, um über Geschlechterrollen, Autorschaft und Empfindsamkeit zu diskutieren.
Anregung:
Man könnte aber ohne literaturhistorischen Kontext sich mal darüber austauschen, inwieweit man etwas beschreiben kann – und auch dichterisch – was man nur aus der Fantasie kennt.
Älteren Leuten könnte Karl May einfallen, der nie im Wilden Westen gewesen war, als er seine Winnetou-Romane u.ä. schrieb – er hatte sich alles angelesen.
Vielleicht einfach auch mal so etwas ausprobieren 😉
7. Einschätzung der Qualität
Das Gedicht ist sprachlich kraftvoll, bildhaft und emotional eindrucksvoll. Die Kombination aus Selbstbehauptung, Kritik und dichterischer Ausdrucksstärke macht es zu einem außergewöhnlichen Zeugnis weiblicher Literatur der Aufklärung. Besonders hervorzuheben ist die Authentizität der Stimme und die Fähigkeit, komplexe Erfahrungen in dichterische Form zu bringen.
8. Persönliche Erst-Reaktion von Mia (fiktive Schülerin)
-
💡 Ich finde es überraschend, dass eine Frau im 18. Jahrhundert so direkt über Gewalt und fehlende Liebe spricht.
-
🤔 Es ist traurig, dass sie ohne Liebe zur Mutter geworden ist – das Gedicht macht nachdenklich.
-
🧠 Ich musste ein paar Verse zweimal lesen, weil die Sprache alt ist, aber es lohnt sich.
-
😠 Der Domherr wirkt überheblich – als ob Frauen nur durch Liebe dichten könnten!
-
😮 Die Stelle mit dem „Krieger“ fand ich schockierend – so etwas habe ich in alten Gedichten nicht erwartet.
-
✍️ Beeindruckend, wie selbstbewusst die Dichterin ihre Perspektive erklärt.
-
🙌 Ich finde gut, dass sie nicht einfach sagt: „Ich liebe“ – sondern erklärt, warum sie schreibt.
-
🎭 Der Vergleich mit Sappho macht klar, wie man sie damals gesehen hat – aber sie geht viel weiter!
-
📚 Ich könnte mir vorstellen, das Gedicht in einem Theaterprojekt zu inszenieren – mit innerem Monolog.
-
💬 Ich wünschte, sie würde heute leben – ich würde ihr auf Instagram folgen!
Epocheneinordnung – zusammengefasst
Kennzeichen der Aufklärung im Gedicht:
-
Rationales Argumentieren: Die Dichterin widerspricht der Aussage des Domherrn sachlich und begründet, warum ihre Poesie nicht aus Liebeserfahrung stammt.
-
Kritik an Vorurteilen: Das Gedicht entlarvt die klischeehafte Vorstellung, dass Frauen nur aus Liebe dichten können.
-
Wahrheitssuche und Aufklärung: Karsch will „Licht ins Dunkel bringen“ – sie klärt auf, woher ihre Dichtung wirklich kommt: aus Leid, nicht aus romantischer Erfahrung.
-
Diskursfähigkeit: Das Gedicht ist ein Beitrag zum öffentlichen literarischen Gespräch und zeigt, dass auch eine Frau darin eine Stimme haben kann.
Kennzeichen des Sturm und Drang im Gedicht:
-
Selbstbewusstes Individuum: Das lyrische Ich tritt stolz und kraftvoll auf – es behauptet sich gegen äußere Urteile.
-
Starke Gefühlsebene: Die Sprache ist emotional, voller Glut, Schmerz und innerer Bewegung.
-
Autobiografische Tiefe: Das Gedicht beruft sich auf persönliche Erfahrung und eigenes Leiden – ein zentrales Motiv im Sturm und Drang.
-
Künstlerisches Genie: Karsch zeigt, dass ihre Dichtung aus innerer Kraft und Fantasie kommt, nicht aus Bildung – typisch für das Ideal des „Naturgenies“ im Sturm und Drang.
👉 Fazit:
Das Gedicht steht an der Schwelle zwischen Aufklärung und Sturm und Drang. Es verbindet klare Argumentation und gesellschaftliche Kritik (Aufklärung) mit emotionaler Tiefe, Ich-Stärke und der Idee des Genies (Sturm und Drang).
Weitere Infos, Tipps und Materialien
- Gedichte der Aufklärung – kurz vorgestellt
https://textaussage.de/gedichte-der-aufklaerung-ueberblick-und-beispiele - Infos, Tipps und Materialien zur deutschen Literaturgeschichte
https://textaussage.de/deutsche-literaturgeschichte-themenseite
— - Infos, Tipps und Materialien zu weiteren Themen des Deutschunterrichts
https://textaussage.de/weitere-infos