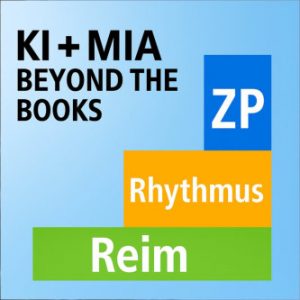 Worum es hier geht:
Worum es hier geht:
Wir stellen hier von Christian Fürchtegott Gellert die Fabel „Das Kutschpferd“ vor, die sehr deutlich eine „Moral“, eine Lehre verkündet, die auch heute noch von Bedeutung ist.
Weiter unten finden sich Fragen, mit denen man sicher Eindruck machen und Zusatzpunkte erreichen kann.
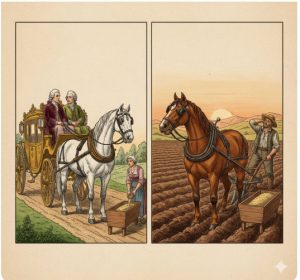
Dies als Vorschaubild von Gemini, das man gut mit dem Text vergleichen kann.
Zu finden ist das Gedicht z.B. hier
http://www.zeno.org/nid/20004806255
Hierzu gibt es auch ein Video:
https://youtu.be/kDwgcC-5_EA
Die Sprungmarken zu den einzelnen Clips
werden noch hinzugefügt.
0:02 – Einführung: Neues Format „KI und Mia“ 0:47 – Gedicht „Das Kutschpferd“ von Gellert: Einstieg und Zielsetzung 1:49 – Erster Teil des Gedichts: Kutschpferd vs. Ackergaul 3:10 – Kommentar des lyrischen Sprechers: Kritik am Müßiggang 4:31 – Zusatzpunkte: Erziehung, Stellung, Nutzen 6:25 – Zweiter Schwerpunkt: Reimschema und KI-Schwächen 7:44 – Komplizierte Reimstruktur: Analyse und Beispiele 9:12 – Dritter Schwerpunkt: Metrum und Rhythmus 10:43 – Vorgehen: mehrsilbige Wörter und Klopfmethode 12:15 – Ergebnis: Jambus mit variabler Hebungszahl 12:46 – Kritik an KI-Fehleinschätzungen (Trochäus, „kein Metrum“) 13:01 – Ausblick: Nutzen der Videos und Einladung zu Fragen
Hier die Dokumentation:
Mat694-gkp bem Gellert Das Kutschpferd – Reim Rhythmus Zusatzpunkte
Christian Fürchtegott Gellert
Das Kutschpferd
- Ein Kutschpferd sah den Gaul den Pflug im Acker ziehn
x X x X x X x X x X x X
Jambus mit sechs Hebungen
einfach mal den Rest in diesem Wechsel-Rhythmus lesen, dann sieht man, ob der Rhythmus einheitlich ist. - Und wieherte mit Stolz auf ihn.
- „Wenn“, sprach es und fing an, die Schenkel schön zu heben,
- „Wenn kannst du dir ein solches Ansehn geben?
- Bis hierhin Paarreime aabb
- Jambus mit sechs Hebungen – überall?
- Und wenn bewundert dich die Welt?“
- „Schweig“, rief der Gaul, „und lass mich ruhig pflügen;
- Denn baute nicht mein Fleiß das Feld:
- Wo würdest du den Hafer kriegen,
- Der deiner Schenkel Stolz erhält?“
- Umarmender Reim, bei dem der erste Reim am Ende noch drangehängt wird.
- cdcdc
- Die ihr die Niedern so verachtet,
- Vornehme Müßiggänger, wißt,
- Dass selbst der Stolz, mit dem ihr sie betrachtet,
- Dass euer Vorzug selbst, aus dem ihr sie verachtet,
- Auf ihren Fleiß gegründet ist.
- Hier haben wir einen noch komplizierteren Reim
- ebeeb
- Ist der, der sich und euch durch seine Händ‘ ernährt,
- Nichts Bessers als Verachtung wert?
- Gesetzt, du hättest bessre Sitten:
- So ist der Vorzug doch nicht dein.
- Denn stammtest du aus ihren Hütten:
- So hättest du auch ihre Sitten.
- Hier wird der Reim noch weiter ausgebaut:
- fghiii
- Und was du bist, und mehr, das würden sie auch sein,
- Wenn sie wie du erzogen wären.
- Dich kann die Welt sehr leicht, ihn aber nicht entbehren.
- hjj
Bitte dieses Reimschema noch mal kontrollieren und dann überlegen, ob dahinter ein Sinn stecken könnte.
1. Einleitung: Verfasser, Titel, Textsorte, Thema
Das Gedicht „Das Kutschpferd“ wurde von Christian Fürchtegott Gellert (1715–1769) verfasst. Gellert war ein deutscher Dichter und Moralphilosoph der Aufklärung, der besonders für seine lehrhaften Fabeln und moralischen Gedichte bekannt ist. Das vorliegende Gedicht ist eine lehrhafte Fabel in Gedichtform, die typische Merkmale der Aufklärung trägt: Rationalität, Moral, Gesellschaftskritik.
Thema:
Das Gedicht thematisiert die Überheblichkeit der höheren gesellschaftlichen Schichten gegenüber den „einfachen Leuten“ und hebt hervor, wie sehr sie in Wahrheit von deren Arbeit abhängig sind.
2. Äußere Form: Aufbau, Reim, Rhythmus
Das Gedicht besteht aus zwei Strophen:
-
1. Strophe (9 Verse): enthält den den eigentlichen Fabelteil mit einem kurzen Dialog zwischen zwei Pferden – mit unterschiedlichen Aufgaben.
-
2. Strophe (13 Verse): enthält die Moral, also die allgemeingültige Lehre für den Leser.
Reimschema – siehe oben
Metrum:
Es beginnt mit einem sechshebigen Jambus – das einfach mal für den Rest selbst kontrollieren.
3. Inhalt & Äußerungen des lyrischen Ichs / Figuren
Das Gedicht enthält kein lyrisches Ich im klassischen Sinne, sondern zwei sprechende Tiere (Personifikation), deren Dialog eine klare gesellschaftskritische Aussage transportiert.
1. Strophe (V. 1–9) – Dialog zwischen Kutschpferd und Ackergaul
-
Das Kutschpferd blickt herab auf den schuftenden Ackergaul (Z. 1–3).
„Wenn“, sprach es und fing an, die Schenkel schön zu heben, […]
-
Es rühmt sich seines schönen Gangs, seiner Bewunderung – sinnbildlich für den Hochmut der „feinen Gesellschaft“.
-
Der Gaul kontert weise und bestimmt (Z. 6–9):
„Denn baute nicht mein Fleiß das Feld:
Wo würdest du den Hafer kriegen […]“ -
Zwischenfazit:
Bereits hier wird die Abhängigkeit der „feinen Leute“ vom einfachen Arbeiter deutlich – obwohl ersterer sich überlegen fühlt, lebt er letztlich vom Fleiß des anderen.
2. Strophe (V. 10–22) – Direkte Moral
-
Ein allwissender Sprecher wendet sich an die „Vornehmen Müßiggänger“ (Z. 10).
-
Der moralische Appell: Verachtet nicht jene, von deren Arbeit ihr lebt.
„Dass euer Vorzug selbst, aus dem ihr sie verachtet,
Auf ihren Fleiß gegründet ist.“ (Z. 13–14) -
Der Sprecher stellt eine hypothetische Gleichstellung auf:
„Denn stammtest du aus ihren Hütten:
So hättest du auch ihre Sitten.“ (Z. 18–19) -
Schlussgedanke (Z. 21–22):
„Dich kann die Welt sehr leicht, ihn aber nicht entbehren.“
– Die vermeintlich Geringen sind unverzichtbar, die Vornehmen nicht. -
Zwischenfazit:
Die moralische Lehre wird explizit: gesellschaftliche Überheblichkeit ist ungerechtfertigt, Bildung und Tugend sind keine angeborenen Privilegien, sondern das Produkt von Erziehung und Lebensumständen.
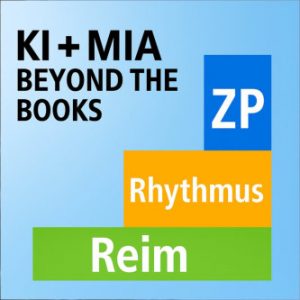 Zusatzpunkt 1: Sicht auf die Elite
Zusatzpunkt 1: Sicht auf die Elite
Frage: Zeigt das Gedicht aus dem 18. Jhdt auf erstaunliche Weise das Missverhältnis in der Einschätzung der scheinbar oberen Schichten – und denen, die real die Arbeit machen?
Man vergleiche das etwa mit dem, was manchmal die Verantwortlichen in einer Firma oder auch in einer Stadt bezahlt bekommen, mit dem, was wirklich an Leistungen sichtbar wird.
Man denke dann etwa an die Mitarbeiter der sog. „Müllabfuhr“, die bei Wind und Wetter stundenlang Mülleimer entleeren. Da kann sich keiner mal eben ausruhen, sondern muss im Takt des Wagens bleiben.
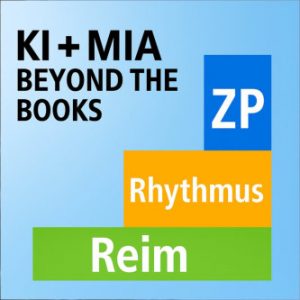 Zusatzpunkt 2: Die Abhängigkeit von Herkunft u. Erziehung
Zusatzpunkt 2: Die Abhängigkeit von Herkunft u. Erziehung
Fast noch interessanter, weil tiefgründiger sind diese beiden Zeilen:
„Denn stammtest du aus ihren Hütten:
So hättest du auch ihre Sitten.“ (Z. 18–19)
Da könnte man die Frage stellen und diskutieren:
Hängt wirklich soviel von Herkunft und Erziehung ab? Oder können sich die „Oberen“ zwar anders geben, aber sind real moralisch und menschlich nicht besser als die „Unteren“? Ist es nicht vielleicht auch so, dass die, die aufgestiegen sind, in der Gefahr sind, das Menschliche zurückzufahren, weil sie ständig mit Menschen zu tun haben, für die sich alles „rechnen“ muss?
4. Zentrale Aussagen des Gedichts
Das Gedicht macht deutlich, dass:
-
Arbeit und Fleiß die Grundlage allen gesellschaftlichen Wohlstands sind (Z. 6–9, 13–14).
-
Soziale Überheblichkeit auf einer Illusion basiert (Z. 10–12).
-
Tugend und Anstand nicht angeboren sind, sondern anerzogen (Z. 18–20).
-
Die sogenannten „niederen“ Schichten sind systemrelevant, die oberen entbehrlich (Z. 21–22).
5. Sprachliche und rhetorische Mittel
-
Personifikation:
Tiere sprechen wie Menschen (Kutschpferd und Gaul) → klassische Fabeltechnik. -
Direkte Rede:
Lebendiger Dialog, ermöglicht klare Gegenüberstellung der Positionen (Z. 2–9). -
Anapher:
„Dass … dass …“ (Z. 12–14) verstärkt die Argumentation. -
Rhetorische Fragen:
„Ist der, der sich und euch durch seine Händ’ ernährt,
Nichts Bessers als Verachtung wert?“ (Z. 15–16)
– appelliert an die Vernunft des Lesers. -
Kontrastierung:
Kutschpferd ↔ Ackergaul, Vornehme ↔ Arbeitende → Verstärkung der zentralen Aussage. -
Hypothetischer Vergleich:
„Gesetzt, du hättest bessre Sitten […]“ (Z. 17–20) – stellt die soziale Willkür in Frage.
Diese Mittel unterstützen die kritische Haltung gegenüber sozialer Ungleichheit und fördern das moralische Nachdenken.
6. Bedeutung / Was fängt man mit dem Gedicht an?
Das Gedicht eignet sich hervorragend, um über:
-
soziale Ungleichheit
-
Arroganz der „Oberschicht“
-
die Würde der Arbeit
-
die Bedeutung von Bildung und Erziehung
zu reflektieren.
Es kann heute noch als Denkanstoß dienen – in Zeiten von sozialer Spaltung, Diskussionen um soziale Gerechtigkeit und systemrelevante Berufe.
7. Einschätzung der Qualität des Gedichts
Gellerts „Das Kutschpferd“ ist ein sprachlich wie inhaltlich gelungenes Lehrgedicht.
Durch die klare Struktur, die fabelhafte Erzählweise und den direkten Appell wird die Botschaft unmissverständlich vermittelt. Die Sprache ist verständlich, aber nicht banal, die Argumentation überzeugend und moralisch fundiert.
Stärken:
-
Klarer Aufbau (Fabel + Moral)
-
Verständliche Sprache
-
Zeitlose Relevanz
-
Wirksame rhetorische Mittel
Schwächen:
-
Metrum nicht ganz konsequent
-
Moral sehr direkt (wenig subtil)
8. 🧍♀️ Persönliche Erstreaktion von Mia (fiktive Schülerin)
-
Ich finde das Gedicht gut verständlich, weil die Tiere reden und das Bild sehr klar ist.
-
Besonders stark finde ich die letzte Zeile: „Dich kann die Welt sehr leicht, ihn aber nicht entbehren.“
-
Es bringt einen wirklich zum Nachdenken über soziale Gerechtigkeit.
-
Ich musste direkt an heutige Berufe denken, die als „niedrig“ gelten, aber voll wichtig sind.
-
Ich finde gut, dass das Gedicht nicht zu lang ist, aber trotzdem eine klare Aussage hat.
-
Die Sprache ist zwar alt, aber nicht so kompliziert wie in anderen Gedichten.
-
Es hat mich ein bisschen wütend gemacht, weil solche Arroganz immer noch existiert.
-
Ich hätte Lust, eine moderne Version davon zu schreiben – vielleicht mit Influencern und Handwerkern.
-
Ich finde es schade, dass der Text keine Überraschung hat – die Moral ist sehr direkt.
-
Trotzdem: Ich würde das Gedicht im Unterricht weiterempfehlen, weil es wichtig ist.
Weitere Infos, Tipps und Materialien
- Gedichte der Aufklärung – kurz vorgestellt
https://textaussage.de/gedichte-der-aufklaerung-ueberblick-und-beispiele - Infos, Tipps und Materialien zur deutschen Literaturgeschichte
https://textaussage.de/deutsche-literaturgeschichte-themenseite
— - Infos, Tipps und Materialien zu weiteren Themen des Deutschunterrichts
https://textaussage.de/weitere-infos