Worum es hier geht:
- Auf der Seite
https://schnell-durchblicken.de/essay-zu-einer-frage-des-zweiten-teils-des-romans-der-vorleser-verstehen-als-voraussetzung-fuer-angemessenes-urteilen
haben wir uns in einem Essay ausführlich mit der Frage beschäftigt, woran eigentlich im Roman „Der Vorleser“ die Gerechtigkeit scheitert. - Daraus ist jetzt eine Kurzfassung entstanden, die ein wichtiges Detail auslässt, es dafür aber in der zweiten Aufgabe nutzt. Dort geht es nämlich um die sog. „Holzbein“-Episode im Roman, in der dem Ich-Erzähler des Romans eine Lehre erteilt wird, die auch für den gesamten Roman von Bedeutung ist.
Hier zunächst eine Vorschau auf die Aufgabenstellung und den Textauszug.
Darunter dann die Download-Möglichkeit.
Darunter dann Aufgabenstellung und Text für individuelle Bearbeitung
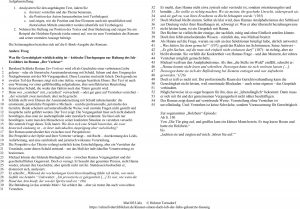
Mat3033-kla Klausur Vorleser verstehen urteilen Holzbein
Aufgabenstellung:
- Analysieren Sie den angehängten Text, indem Sie
- ihn kurz vorstellen und das Thema benennen,
- die Position des Autors herausarbeiten (mit Textbelegen)
- und zeigen, wie die Position und ihre Elemente auch mit sprachlichen und rhetorischen Mitteln unterstützt werden (ebenfalls mit Textbelegen)
- Nehmen Sie Stellung zur Position des Textes und ihrer Bedeutung und zeigen Sie am Beispiel der Holzbein-Episode (siehe unten) auf, was sie zum Verständnis des Romans und seiner zentralen Aussage beiträgt.
Die Seitenangaben beziehen sich auf die E-Book-Ausgabe des Romans.
Text der Klausur
Anders Tivag
Was für Gerechtigkeit wirklich nötig ist – kritische Überlegungen zur Haltung des Ich-Erzählers im Roman „Der Vorleser“
Bernhard Schlinks Roman Der Vorleser wird oft als Geschichte einer verbotenen Liebe gelesen – oder als literarische Auseinandersetzung mit Schuld, Scham und dem Umgang der Nachgeborenen mit der NS-Vergangenheit. Diese Lesarten sind nicht falsch. Doch gerade im zweiten Teil des Romans zeigt sich eine tiefere, weniger beachtete Ebene: Der Text ist auch eine Warnung vor einer gefühlsmäßig aufgeladenen, aber unreflektierten Beurteilung historischer Schuld, die weder den Opfern noch den Tätern gerecht wird.
Denn wer „verstehen“ mit „verzeihen“ verwechselt – oder gar ganz auf Verstehen verzichtet –, der verurteilt zwar moralisch, aber nicht gerecht.
Schlink stellt zwei Ebenen der Auseinandersetzung mit Schuld nebeneinander: die emotionale, persönliche Perspektive Michaels – und die professionelle, juristische des Gerichts. Beide scheitern auf unterschiedliche Weise, weil zentrale Fragen nicht gestellt und Gespräche nicht geführt werden. Der Text zeigt: Die Vergangenheit lässt sich nicht dadurch bewältigen, dass man sie nachempfindet oder moralisch verdammt. Sie lässt sich nur bewältigen, wenn man den Menschen in seiner konkreten Situation zu verstehen versucht.
Die zentrale Frage dieses Teils lautet: Wie lässt sich eine Schuld beurteilen, die zwar historisch eindeutig ist – in ihrer individuellen Ausprägung aber vielschichtig?
Der Roman unterscheidet hier zwischen zwei Perspektiven:
Die Perspektive der Opfer und ihrer Vertreter verlangt – mit Recht – Anerkennung des Leids, Aufarbeitung, und eine symbolisch und juristisch wirksame Verurteilung.
Die Perspektive der Täterin verlangt natürlich keine Entschuldigung, aber ein Verstehen der Umstände, unter denen Schuld entstand – um das Maß der individuellen Verantwortung zu bestimmen.
Michael könnte das fehlende Bindeglied sein – zwischen Hannas Vergangenheit und der gesellschaftlichen Gegenwart. Doch er versagt. Er besucht den gesamten Prozess, sieht Hanna wieder, erkennt ihre Geschichte, aber spricht nicht mit ihr. Stattdessen beobachtet er, distanziert sich, analysiert.
Er schreibt: „Während der wochenlangen Gerichtsverhandlung fühlte ich nichts, war mein Gefühl wie betäubt.“ Und weiter: „Ich provozierte es gelegentlich […] Es war, wie wenn die Hand den Arm kneift, der von der Spritze taub ist.“ (96)
Die Betäubung ist das zentrale Motiv: Sie schützt ihn – aber sie trennt ihn auch vom echten Verstehen.
Er merkt, dass Hanna nicht etwa zynisch oder verstockt ist, sondern orientierungslos und bemüht: „Sie wollte es richtig machen. Wo sie meinte, ihr geschehe Unrecht, widersprach sie, und sie gab zu, was ihres Erachtens zu Recht behauptet wurde.“(105)
Doch Michael bleibt stumm. Selbst als klar wird, dass Hannas Analphabetismus der Schlüssel zur Deutung vieler ihrer Handlungen ist, schweigt er: Was er aber übersieht beziehungsweise nicht leisten kann, ist ein Gespräch mit Hanna.
Der Richter ist vielleicht der einzige, der sachlich, ruhig und ohne Eitelkeit urteilen könnte. Doch ihm fehlt entscheidendes Wissen – nämlich das, was Michael besitzt.
Als Hanna auf die Frage, warum sie sich an den Selektionen beteiligt habe, ehrlich antwortet: „Was hätten Sie denn gemacht?“ (107), gerät der Richter ins Schwimmen. Seine Antwort – „Es gibt Sachen, auf die man sich einfach nicht einlassen darf“ (107)– ist richtig, aber sie bleibt abstrakt. Sie verfehlt die Konkretheit von Hannas Frage – und den Moment, der echtes Verstehen möglich gemacht hätte.
Michael weiß um den Analphabetismus. Als ihm „die Stelle im Wald“ einfällt, schreibt er:
„Hanna konnte nicht lesen und schreiben. Deswegen hatte sie sich vorlesen lassen […]. Deswegen hatte sie sich der Beförderung bei Siemens entzogen und war Aufseherin geworden.“(126)
Doch er teilt es nicht mit. Der professionelle Raum der Gerichtsverhandlung kann die Gerechtigkeit nicht leisten, weil emotionale Blockaden – auch seine eigenen – das Gespräch verhindern.
Möglicherweise ist es sogar bequem für ihn, dass sie „lebenslänglich“ bekommt: Dann muss er sich mit ihr und der gemeinsamen Vergangenheit nicht näher beschäftigen.
Der Roman zeigt damit auf verstörende Weise: Verurteilung ohne Verstehen ist unvollständig. Und: Verstehen ist keine Schwäche, sondern Voraussetzung für Gerechtigkeit.
Hinweis zur sogenannten „Holzbein“-Episode:
Ab S. 150
Von „Die Tür ging auf, und grußlos kam ein kleiner Mann herein. Er trug kurze Hosen und hatte ein Holzbein.“
bis
„lachten sie und zeigten auf mich. ‚hören Sie auf.‘“
Erwartungshorizont
Weitere Infos, Tipps und Materialien
- Infos, Tipps und Materialien zum Roman „Der Vorleser“
https://textaussage.de/schlink-vorleser-themenseite
— - Klausuren – Sammlung
https://textaussage.de/sammlung-klausuren
— - Infos, Tipps und Materialien zu weiteren Themen des Deutschunterrichts
https://textaussage.de/weitere-infos