Worum es hier geht:
Wir stellen hier ein interessantes Gedicht vor aus der Zeit des Expressionismus. Es ist wie viele der Texte der Zeit kritisch gegenüber den Menschenmassen, das lyrische Ich kann sich aber retten in die stille Steinwelt des Abends. Dort findet es Frieden und zeigt sogar romantische Fantasie.
In dieser Audiodatei zeigen wir, wie man fortlaufend dieses Gedicht verstehen kann.
Zu finden ist es hier:
Reclam: Großstadtlyrik – RUB: 9639, Seite 76
ISBN: 978-3-15-009639-0
1. Einleitung: Verfasser, Titel, Art, Thema
Das Gedicht „Steine; nicht Menschen“ wurde von Max Brod (1884–1968) verfasst, einem deutschsprachigen Schriftsteller, Komponisten und bedeutenden Förderer Franz Kafkas. Brod wird häufig der literarischen Moderne bzw. dem Prager Kreis zugeordnet.
- Bei dem Text handelt es sich um ein lyrisches Gedicht, das in einer Großstadt angesiedelt ist.
- Im Zentrum steht die Beziehung des lyrischen Ichs zur städtischen Umgebung, insbesondere zu den Straßen und Pflastersteinen, denen es mehr Vertrautheit und Ruhe zuspricht als den Menschen.
- Das Thema kreist um Entfremdung, ästhetische Wahrnehmung und eine innere Zuwendung zur unbelebten Umwelt.
2. Äußere Form: Reim und Rhythmus
Das Gedicht besteht aus zwei Abschnitten, die sich in Ton und Struktur unterscheiden:
- Der erste Abschnitt umfasst 9 Zeilen, mit kurzem, emotionalem Ausdruck.
- Der zweite, deutlich längere Abschnitt besteht aus 15 Zeilen.
Der Reim ist uneinheitlich
- 1–4: „gekehrt / Abendruhe / Unruhe / bekehrt“ – hier taucht ein Kreuzreim auf, aber dieser wird später nicht durchgehalten.
- 10–13: Wiederholung von Endungen mit -ungen.
- Viele Verse sind frei rhythmisiert, was die emotionale Unruhe bzw. das Abweichen von strengen Konventionen widerspiegeln könnte.
3. Inhalt und lyrisches Ich (mit Zwischenfazits)
Strophe 1 (Z. 1–9)
„Die Gassen, die wie gekehrt / Sind in der Abendruhe, / Haben mich von meiner Unruhe / Bekehrt.“
Das lyrische Ich erlebt die abendliche Leere der Stadtgassen als wohltuend. Es beruhigt sich innerlich, wird „bekehrt“ durch die äußere Ruhe.
„Ich denke an verschiedene Dinge, / Die ich nicht sagen will. / Ich bin doch glücklich. Still! / Und sage nichts und singe / Nichts.“
Ein inneres Glück wird beschrieben, das jedoch wortlos bleibt. Die bewusste Weigerung, zu singen oder zu sprechen, betont eine stille, kontemplative Haltung.
→ Zwischenfazit: Der Leser spürt zunächst eine ambivalente Stimmung – zwischen innerer Unruhe und äußerer Beruhigung, ein vorsichtiges Zurückziehen aus der lauten Welt.
Strophe 2 (Z. 10–24)
„Die Pflastersteine sind meine Vertrauten…“
Die unbelebten Steine erscheinen dem lyrischen Ich als Freunde und Vertraute. Ihre Formen und Strukturen werden als ästhetisch wahrgenommen („Freskogemälde“, Z. 14).
„Steine sind gut. Wir Menschen sind wilder.“
Diese zentrale Aussage (Z. 17) enthält eine deutliche Kritik an der Menschheit, verbunden mit einer Aufwertung des Unbelebten. Der Mensch erscheint chaotisch, destruktiv – im Gegensatz zur stillen Ordnung der Steine.
„In den Lücken… ist vielerlei Gestalt“, „Pfütze… so dunkel und alt“
Das lyrische Ich projiziert Emotionen auf Details der Pflasterung, sieht Ohren, Tore, Gesichter – das spricht für eine intensive ästhetische und emotionale Durchdringung der Umwelt.
→ Zwischenfazit: Der Leser erkennt eine klare Abwendung vom Menschen hin zu einer scheinbar bedeutungsvollen, fast beseelten Materie. Diese Wendung gibt dem Gedicht eine melancholische, aber auch liebevolle Tiefe.
Weiter unten sind wir darauf eingegangen, wie man das Problem mit der Zeile 10 lösen kann.
4. Zentrale Aussagen
Das Gedicht zeigt:
- Eine Zuwendung zu unbelebten Dingen (Steinen), die als verlässlicher, ruhiger und bedeutungsvoller empfunden werden als Menschen. (Z. 10–17)
- Die Schönheit städtischer Struktur wird erst in der Leere sichtbar, wenn Menschen abwesend sind. (Z. 18–19)
- Poesie und tiefes Empfinden entstehen im Stillen, nicht im Ausdruck oder in der Gesellschaft. (Z. 5–9) Diese steht sogar für „Feinde des Lichtes“ – Licht steht hier für die eigenen Gedanken und das Rauslassen von Gefühlen, was in der abendlichen Ruhe gelingt.
- Eine gewisse Weltflucht oder Resignation, die sich aber nicht ins Negative kehrt, sondern in ästhetische Entdeckung und Empfindsamkeit mündet.
5. Sprachliche und rhetorische Mittel
- Personifikation: Steine haben Ohren, Tore, sehen wie Menschen aus → unterstützt die Aussage, dass das Ich sie als vertraute Wesen empfindet (Z. 22–24).
- Alliteration: „Pflastersteine – Vertraute“, „Pfütze – weinen“ – klanglich verstärkend.
- Metapher: „Straßen sind hingelegte Bilder“ (Z. 16) – visuelle Wahrnehmung wird künstlerisch gedeutet.
- Wiederholungen: „schöne Zeichnungen“, „schöne Wiederholungen“ – unterstreicht die Schönheit des Pflasters.
- Kontraste: Steine vs. Menschen („Steine sind gut. Wir Menschen sind wilder.“) → zentrale Wertung (Z. 17).
6. Was kann man mit dem Gedicht anfangen?
- Das Gedicht eignet sich hervorragend, um eine Großstadt-Umgebung poetisch zu reflektieren.
- Es lädt dazu ein, gewohnte Stadträume neu zu betrachten – mit Achtsamkeit für das scheinbar Unscheinbare.
- Auch Themen wie Entfremdung, Zivilisationskritik und die Rolle von Kunst und Wahrnehmung können erarbeitet werden – sowohl im Literaturunterricht als auch in philosophischen Kontexten.
- Man kann aber das Gedicht auch einfach als Anlass nehmen für die Frage, wo und wie man selbst Ruhe findet.
7. Qualität des Gedichts – Einschätzung
- „Steine; nicht Menschen“ ist ein vielschichtiges, sensibel komponiertes Gedicht, das ohne große sprachliche Ausschweifungen eine tiefe innere Bewegung abbildet.
- Besonders gelungen ist der Kontrast zwischen Stille und innerer Fülle, sowie die originelle Perspektive, aus der städtisches Leben beschrieben wird.
- Die sprachlichen Mittel sind dezent, aber wirkungsvoll eingesetzt. Die poetische Subjektivität wirkt echt und nicht konstruiert – das macht das Gedicht besonders überzeugend.
- Insgesamt ein Gedicht, das die städtische Welt mit ihren Menschenmassen kritisch sieht, aber ansonsten sich in einen Ausschnitt der Stadtwelt fast romantisch hineinfantasiert.
- Nicht typisch für den Expressionismus.
8. Persönliche Erstreaktion von Mia (fiktive Schülerin)
- Ich finde die Idee schön, dass man sogar in Pflastersteinen etwas Lebendiges und Vertrautes sehen kann.
- Es hat mich überrascht, wie das Gedicht so ruhig und trotzdem so traurig wirken kann.
- Ich mag den Satz „Steine sind gut. Wir Menschen sind wilder.“ – da steckt viel drin.
- Am Anfang war es schwer zu verstehen, was das lyrische Ich genau meint.
- Die vielen Bilder (wie das Fresko) regen die Fantasie an.
- Ich finde es interessant, dass das Ich lieber mit Steinen „redet“ als mit Menschen.
- Manche Stellen wirken wie ein inneres Tagebuch – sehr persönlich.
- Es macht nachdenklich: Was sehen wir im Alltag eigentlich nicht, weil wir es übersehen?
- Ich würde gerne ein eigenes Foto von einer Pflasterstraße machen und mit Versen aus dem Gedicht kombinieren.
- Das Gedicht hat etwas Tröstliches – als ob es okay ist, sich mal zurückzuziehen.
Spezialthema: Zeile 10 sicher verstehen
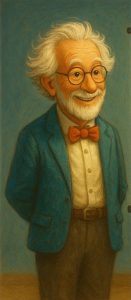
Auf der Seite
https://textaussage.de/fehler-vermeiden-bei-der-analyse-und-interpretation-von-gedichten
sammeln wir mögliche Gefahrenstellen beim Interpretieren und wie man sie umgehen kann.
Was die Zeile 10 angeht, haben wir da Folgendes als Hilfe zusammengestellt:
Beispiel für eine schwierige Verszeile, bei der man nicht der ersten Idee folgen darf:
https://schnell-durchblicken.de/max-brod-steine-nicht-menschen
- In den ersten 4 Zeilen ist von der inneren Ruhe die Rede, die das lyrische Ich am Abend erlebt, wenn die „Gassen“ von den Menschen „gekehrt“, also befreit worden sind, wie von Staub.
- In den nächsten 5 Zeilen will das lyrische Ich nichts von dem preisgeben, was es an Gedanken hat, die es glücklich machen.
- Dann die entscheidende Zeile:
„Denn das ist nichts für Feinde des Lichts.“ - Jetzt darf man dieses Licht nicht mit dem Tag in Verbindung bringen, der ja jetzt in den Abend, also ins Dunkle übergeht.
- Vielmehr ist wichtig zu erkennen, dass die Gedanken und das, was das lyrische Ich gerne hinaussingen würde, nichts ist für die „Feinde des Lichts“
- Dann liegt es nahe, das Licht auf die Gedanken und den möglichen Gesang, also den inneren Reichtum zu beziehen, der sich am Abend für das lyrische Ich ergibt.
- Und die „Feinde“ sind dann wohl die, von denen die „Gassen“ gekehrt, also befreit worden sind, also die Menschen.
- Fazit: Wenn man einen Zusammenhang sieht, der wie eine Sackgasse zu keinem neuen Ergebnis führt, einfach noch mal „neu“ denken – zurück auf 0, die erste Idee auf einen Zettel schreiben und dann vergessen – und dann neu denken., indem man sich fragt, worauf könnte das Licht sich beziehen – und wer sind dann die Feinde.
Weitere Infos, Tipps und Materialien
- Stadtgedichte – Sammlung
Sammlung von Gedichten, die jeweils kurz vorgestellt werden, auch mit Hinweisen auf ihren Einsatz im Unterricht bzw. speziell bei Klassenarbeiten und Klausuren
https://textaussage.de/sammlung-stadtgedichte
— - Stadtgedichte – nach Themen sortiert
https://textaussage.de/stadtgedichte-nach-themen-sortiert-stadtgedichte-finder
— - Stadtgedichte: Infos, Tipps und Materialien
https://textaussage.de/thema-stadt-in-gedichten-infos-tipps-und-materialien-themenseite
— - Infos, Tipps und Materialien zu weiteren Themen des Deutschunterrichts
https://textaussage.de/weitere-infos