Worum es hier geht:
Auf der Basis unserer Anmerkungen und Lösungshinweise auf der Seite:
https://schnell-durchblicken.de/michael-spyra-der-erste-eigene-syrer
haben wir ChatGPT eine ausformulierte Musterlösung zu erstellen.
Auch da wurden der KI noch Hinweise zum Aufbau gegeben.
Dies ist also nicht das Ergebnis von Faulheit, sondern ein weiterer Versuch, ChatGPT zu testen. Was kann es – und wo sind noch Grenzen oder sogar Fehler.
Wir präsentieren hier nun die Lösung – und werden das verbessern, was uns nicht gut genug erscheint.
Wie immer lassen wir das MIA machen, unserer „menschlichen (!!!) Intelligenz in Aktion“.
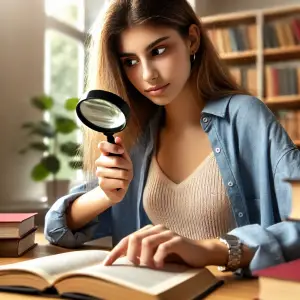
Zu finden ist das Gedicht übrigens hier.
https://signaturen-magazin.de/michael-spyra–der-erste-eigene-syrer.html
Die „Musterlösung“ (KI und MIA)
Einleitung:
In dem Gedicht „Der erste eigene Syrer“ von Michael Spyra, erschienen 2015, wird in satirisch-ironischer Weise gezeigt, wie oberflächlich manche Menschen mit dem Thema Integration umgehen und wie sie sich dabei selbst bestätigen möchten.
- MIA: Das ist eine sehr gelungene Themenformulierung.
- weil zwei Elemente genannt werden:
- zum einen die Oberflächlichkeit
- zum anderen das Interesse an Selbstbestätigung.
- weil zwei Elemente genannt werden:
- MIA: Allerdings zeigt ein kurzer Blick auf die Quellenseite, dass das Datum nicht stimmt. Dort wird der 20.8.2019 genannt.
Inhaltsbeschreibung:
- Das lyrische Ich schildert eine Szene in einer bürgerlichen Siedlung, wo ein Sommerfest stattfindet.
- MIA: Hier wird erst mal insgesamt beschrieben, was das präsentiert wird.
- In der ersten Strophe (Z. 1–5) wird die Idylle beschrieben: geschlossene Schranke, gepflegte Gärten, Salat und Quiche, ein Korb mit Hausschuhen für Gäste.
- MIA: Durch die Bezeichnung als „Idylle“ gibt es hier mehr als eine reine Wiedergabe dessen, was da im Gedicht steht.
- In der zweiten Strophe (Z. 6–9) erscheint ein syrischer Geflüchteter unter den Gästen – er ist nicht zum ersten Mal dabei, wird freundlich integriert, aber bleibt klar als ‚der Syrer‘ markiert.
- MIA: Das mit der Flucht sollte als Vermutung gekennzeichnet werden.
- MIA: Ähnlich wie „Idylle“ zeigt hier das „markiert“, wie die Situation des Syrers ist – er ist nicht einfach einer von allen, sondern eben was Besonderes.
- Die dritte Strophe (Z. 10–12) beschreibt, dass er nun selbstverständlich mithilft und sogar ein Glas Wein trinkt – alles läuft reibungslos.
- MIA: Das ist recht gut zusammengefasst. Man könnte anmerken, dass er als einziger hier etwas tut, man weiß nicht, warum das genannt wird.
- MIA: Aber man kann den Eindruck haben, dass er hier wie ein Bediensteter präsentiert wird – was an alte, koloniale Zeiten erinnern könnte. Man könnte also zusammenfassend wie „Idylle“ und „markiert“ so etwas sagen wie „teil-integriert“.
- In der letzten Strophe (Z. 13–15) wird die gute Anpassung noch einmal betont, gipfelnd in der fast spöttisch wirkenden Geste, ihm ein Würstchen zu reichen.
- MIA: Hier fehlt die Einbeziehung des Wortes „Schelm“ – das geht in die Richtung eines „Schelmenstreiches“, der bei nicht ganz Gleichberechtigten immer etwas problematisch ist.
- MIA: Man könnte eher formulieren, das hier etwas abgeht zwischen Test der Integration, vielleicht auch Anerkennung, aber aus der Sicht der Mehrheitsgesellschaft.
Aussage mit vertiefter Analyse:
- Das Gedicht wirkt auf den ersten Blick freundlich, entlarvt aber eine Haltung, in der Integration nur als bequemes Symbol funktioniert.
- MIA: Das ist eine ziemlich professionell wirkende Formulierung. Eine gute Übung, das mal auf die Ebene von Schüler-Normal-Deutsch zu bringen:
„Das Gedicht wirkt auf den ersten Blick freundlich. Deutlich wird aber, dass hier Integration im Sinne von „er ist einer von uns“ nicht überzeugend präsentiert wird. Der „Schelmenstreich“ ist entweder eine Falle – oder aber eine ironische Geste, die deutlich macht: Ich weiß, dass du als Muslim kein Schweinefleisch isst, und bin gespannt, wie elegant du dich da aus der Affäre ziehst. Gute Gelegenheit, so etwas zu trainieren – aber hier muss es einvernehmlich sein.
- MIA: Das ist eine ziemlich professionell wirkende Formulierung. Eine gute Übung, das mal auf die Ebene von Schüler-Normal-Deutsch zu bringen:
- Der Titel „Der erste eigene Syrer“ spielt mit der Doppeldeutigkeit des Wortes „eigen“ – als Besitzanzeige.
- MIA: Das ist nicht ganz klar:
Besser wäre „Der Titel „Der erste eigene Syrer“ spielt mit einem Attribut, das hier nicht passt. Denn Menschen werden nicht zu Eigentum. Hier macht es geschickt deutlich, dass hier nicht jemand als Mensch zum Eigentum gemacht wird, sondern diese Selbst-Beweihräucherung: Wir gehören zu den Guten, wir können jetzt auch einen vorzeigen, an dem man sieht, wie multikulturell-freundlich wird sind.“
- MIA: Das ist nicht ganz klar:
- Die Szene wirkt inszeniert: Der Korb mit Überziehern (Z. 4) steht symbolisch für das bürgerliche Bedürfnis nach Sauberkeit und Einheitlichkeit – alle Gäste passen hinein.
- MIA: „Inszeniert“ ist hier aber eher eine Außenbetrachtung – die Beteiligten werden das als ganz normal ansehen und das Wort „Inszenierung“ eher als Vorwurf empfinden.
- In Ordnung ist die Formulierung, wenn es um die Wirkung geht, die das lyrische ich hat und vermitteln will.
- Der Syrer „fügt sich sehr gut ein“ (Z. 14), was scheinbar lobend, aber auch kontrollierend klingt: Er erfüllt die Erwartungen perfekt.
- Hier könnte man diskutieren, was „Integration“ von der Wortbedeutung her bedeutet und was damit bei uns heute gemeint ist.
- Das Gedicht kritisiert, wie sehr der Geflüchtete zur Trophäe der gelungenen Integration gemacht wird.
- MIA: Wieder eine sehr professionelle Formulierung: Man könnte also auch sagen:
„Das Gedicht kritisiert, wie sehr Geflüchtete auch Teil einer Selbstdarstellung werden, bei der ein Mensch eben der Syrer bleibt und nicht einfach als Achmed neben Olaf und Sven aufgeführt wird.
- MIA: Wieder eine sehr professionelle Formulierung: Man könnte also auch sagen:
Sprachliche Mittel:
- Das Gedicht arbeitet mit feiner Ironie. Schon in Z. 3 („Salat und Quiche und Wein auf den Terrassen“) wird die Vorzeigebürgerlichkeit deutlich.
- Der Syrer wird nicht als Individuum vorgestellt, sondern nur durch seine Rolle im Gastgebergefüge.
- Der Reim in der zweiten Strophe („Gästen“ – „befassen“ – „Sommerfesten“, Z. 7–9) erzeugt eine leicht verspielt-lyrische Stimmung, die die Oberflächlichkeit zusätzlich betont.
- Auch das Partizip „eingefügt“ (Z. 14) zeigt, wie glatt die Integration äußerlich verläuft – ohne Reibung, aber auch ohne echte Begegnung.
- MIA: Insgesamt könnte man hier mehr von der Aussage ausgehen:
Dass es hier mehr um ein Vorzeigen geht als um Integration wird besonders deutlich:- am Bild der Schranke, die geschlossen ist. Das deutet eine Haltung an, die vom Anlass her verständlich ist: Wir wollen unter uns bleiben. Das kann dann aber auch übertragen werden auf die Frage, wie geht man mit Flüchtlingen um, die die inneren Schranken der Leute übersprungen haben und damit zur Herausforderung geworden sind.
- Dann die Einbeziehung und Vorstellung der „Überzieher“, die „jedem Gast“ passen „wie angegossen“ – ein deutlicher Hinweis auf eine Art von erwarteter Gleichheit.
- Dann die Forderung nach Dankbarkeit in Zeile 13 dafür, dass der Fremde sich sehr gut einfügt. Was wäre, wenn er das nicht tut. Wie sähe dann Umgang mit Undankbarkeit aus? So eine Szene könnte man mal spielen.
- Am Ende dann die Idee mit dem „Schelm“, ein Wort, das aus einer Zeit stammt, in der damit Menschen bezeichnet wurden, die sich nicht an die bürgerlichen Regeln hielten. Eine lohnende Recherche-Aufgabe.
Auf jeden Fall ist hier eine Andeutung, dass mit dem Syrer nicht ganz fair, menschlich umgegangen wird, wenn ihm ein Würstchen auf den Teller gelegt wird – unter den Voraussetzung, dass er so etwas aus religiösen Gründen nicht essen darf oder will.
- MIA: Insgesamt könnte man hier mehr von der Aussage ausgehen:
Deutung/Interpretation/Bedeutung des Gedichtes, Anwendungsmöglichkeiten
- Das Gedicht kritisiert eine bürgerliche Selbstzufriedenheit, die Integration als Leistung verbucht, solange sie nicht stört.
- Es zeigt, wie schnell ein Mensch zur Trophäe wird: Der Syrer wird nicht gesehen, sondern vorgezeigt.
- Die Satire liegt in der höflich-geschliffenen Form und dem scheinbar anerkennenden Ton.
- Gerade das letzte Bild – ein Schelm legt ihm ein Würstchen auf den Teller (Z. 15) – kann man doppeldeutig lesen: als banalen Akt der Gastfreundschaft oder als symbolisches Abrunden des gelungenen Einfügens.
- So wird die Integrationsleistung des Gastgebers zelebriert, nicht der Mensch selbst gewürdigt.
- MIA: Gute Ideen, aber zum Teil auch Wiederholung von Aussagen.
- Man könnte deutlicher darauf hinweisen, dass es ein gutes Beispiel ist für Bemühen um Gutsein, bei dem es weniger um das „Sein“ geht als um das „Zeigen“ von realem oder angeblichem Gutsein.
Weitere Infos, Tipps und Materialien
- Thema Reisegedichte Teilthema Heimat und Fremde
https://textaussage.de/thema-reisegedichte-teilthema-heimat-und-fremde
—
- Infos, Tipps und Materialien zu politischen Gedichten
https://textaussage.de/themenseite-politische-lyrik
— - Infos, Tipps und Materialien zu weiteren Themen des Deutschunterrichts
https://textaussage.de/weitere-infos