Worum es hier geht:
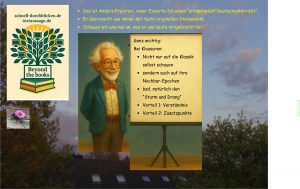
Auf der Seite
https://schnell-durchblicken.de/klausurvorbereitung-die-wichtigsten-gedichte-der-epoche-der-klassik
haben wir wichtige Gedichte der Klassik zusammengestellt – als Vorbereitung auf eine entsprechende Klausur.
Es lohnt sich aber aus zwei Gründen, sich auch mit Gedichten des Übergangs zwischen „Sturm und Drang“ und „Klassik“ zu beschäftigen.
- Zum einen könnte ein Gedicht diesen Übergang enthalten und es wird in der Aufgabenstellung thematisiert.
- Oder aber man besorgt sich Zusatzpunkte, indem man an entsprechenden Stellen auf Gemeinsamkeiten oder Unterschiede verweist.
Die folgende vorläufige Zusammenstellung haben wir uns von NotebookLM erstellen lassen und werden sie noch kommentieren.
Aber allein das Durchlesen der Beispiele lohnt sich, weil man dann ein Gefühl bekommt, wie man auch bei einem ganz anderen Gedicht mit der Frage der Doppel-Epoche umgehen kann.
Vorstellung von Gedichten zwischen SuD und Klassik
- Die Zeit Goethes, oft als „Goethezeit“ bezeichnet (ca. 1770-1830), umfasste streng genommen drei Epochen: den Sturm und Drang, die Klassik und die Romantik.
- Johann Wolfgang von Goethe selbst gilt als typischer Vertreter beider Epochen (Sturm und Drang und Weimarer Klassik) und vollzog eine Entwicklung vom leidenschaftlichen „Stürmer und Dränger“ hin zum „Klassiker“.
- Seine Italienreise im Jahr 1786 wird oft als Beginn der deutschen Klassik und als Wendepunkt in seinem Schaffen angesehen.
Hier sind fünf Gedichte, die diese Übergangsphase oder die thematische Auseinandersetzung damit verdeutlichen:
Goethe, Natur und Kunst
https://schnell-durchblicken.de/goethe-natur-und-kunst
- Das Gedicht betrachtet die Natur, also all das Ungestüme, auch Geniehafte im Menschen nur noch als Vorstufe zur Einbindung in einen Zusammenhang von Form und Inhalt – eben klassisch.
- Es geht um „Bildung“ im Sinne von sich anstrengen, um mit Plan und Disziplin höhere Ziele zu erreichen. Wichtig ist die Bindung an sie und an die sie tragenden Prinzipien.
- Und nur vor diesem Hintergrund mag „frei Natur im Herzen wieder glühen“. Das heißt: Die Natur in Freiheit darf eine Rolle spielen, ist und bleibt auch Basis für künstlerische Genialität, aber sie wird eben eingebunden.
Der Erlkönig (Johann Wolfgang von Goethe)
https://textaussage.de/goethe-erlkoenig-klassenarbeit
- Entstehungszeit: 1782.
- Verortung im Übergang: Goethes „Erlkönig“ gilt explizit als Wendewerk vom Sturm und Drang hin zur Weimarer Klassik.
- Elemente des Sturm und Drang:
Intensive Emotion und Subjektivität:
Das Gedicht ist geprägt von der panischen Angst des Kindes und der Verzweiflung des Vaters angesichts des übernatürlichen Erlkönigs [aus vorheriger Antwort]. Dies spiegelt die Betonung starker Gefühle, Triebe und Spontaneität wider, die für den Sturm und Drang charakteristisch sind. Die direkten Ausrufe des Kindes („Mein Vater, mein Vater!“) sind bezeichnend für die affektbetonte, ungebändigte Sprache der Epoche [3, aus vorheriger Antwort].
Natur als Spiegel des Inneren:
Die dunkle, bedrohliche Nacht und die unheimliche Präsenz des Erlkönigs in der Natur verstärken die inneren Ängste und stehen im Einklang mit der stürmerischen Auffassung der Natur als Ausdruck innerer Zustände [79, aus vorheriger Antwort].
- Elemente der Klassik:
◦ Formale Strenge (Balladenform): Trotz der emotionalen Wucht ist „Der Erlkönig“ eine Ballade, eine Gedichtform, die in der Klassik, insbesondere im „Balladenjahr“ 1797, sehr beliebt war. Die regelmäßige Strophenform, das Reimschema und das Versmaß zeigen ein Streben nach formaler Ordnung und Ästhetik, Merkmale der Klassik [10, 13, 79, aus vorheriger Antwort].
◦ Streben nach Vernunft und Gleichgewicht: Der Vater versucht, die Visionen des Kindes rational zu erklären, auch wenn er scheitert. Dies kann als Versuch interpretiert werden, rationale Erklärungen für emotionale und unheimliche Wahrnehmungen zu finden, was dem klassischen Streben nach einem harmonischen Gleichgewicht aus Verstand und Gefühl entspricht [10, aus vorheriger Antwort].
- Anteile: Der „Erlkönig“ zeigt eine starke Dominanz stürmerischer Emotionalität und Thematik, die jedoch durch eine bereits klassisch anmutende, geordnete Balladenform gebändigt wird. Der Konflikt zwischen dem Irrationalen (Sturm und Drang) und dem Versuch der Rationalisierung (Klassik) steht im Zentrum.
„Beispiel“ (Johann Wolfgang von Goethe)
Ein ganz kurzes Gedicht, das aber auch viel aussagt zu unserem Thema
Zu finden ist es z.B. hier.
Goethe
Beispiel
- Wenn ich ‚mal ungeduldig werde,
- Denk‘ ich an die Geduld der Erde,
- MIA: Das ist der typische Blick des klassischen Goethe auf die großen Zusammenhänge der Natur.
- Die, wie man sagt, sich täglich dreht
- Und jährlich so wie jährlich geht.
- Hier werden die großen Gesetze der Natur deutlich.
- Bin ich denn für was Andres da? –
- Ich folge der lieben Frau Mama.
- Das bezieht sich wohl auf die oben genannte Erde und macht noch einmal deutlich, dass das lyrische Ich sich nicht auflehnt, sondern einordnet – und daraus Geduld zieht.
- Entstehungszeit: Das Gedicht ist in der Zeit von 1765 bis 1832 entstanden und wird den Epochen Sturm und Drang sowie Klassik zugeordnet.
- Elemente des Sturm und Drang:
◦ Ausgangspunkt Emotion: Die erste Zeile „Wenn ich mal ungeduldig werde“ verweist auf eine persönliche, subjektive Empfindung oder einen Trieb, der im Sturm und Drang zentral ist.
- Elemente der Klassik:
◦ Reflexion und Geduld: Das lyrische Ich wendet sich der „Geduld der Erde“ zu und folgt der „lieben Frau Mama“. Dies weist auf eine Hinwendung zu Besonnenheit, Ordnung und Akzeptanz des Gegebenen hin, was im Gegensatz zum rebellischen Geist des Sturm und Drang steht. Die Natur dient hier nicht als Spiegel des inneren Chaos, sondern als Vorbild für Beständigkeit und Geduld.
◦ Einfache, klare Sprache und Form: Das Gedicht ist kurz (6 Verse, 2 Strophen) und in einer klaren, einfachen Sprache gehalten. Dies entspricht der klassischen Tendenz zu sprachlicher Klarheit und formaler Struktur, anstatt der oft „rohen und derben“ Sprache oder „freien Formen“ des Sturm und Drang.
- Anteile: Das Gedicht zeigt einen starken Anteil an klassischen Tugenden wie Geduld, Ordnung und Akzeptanz, die einer anfänglich erwähnten, eher stürmerischen „Ungeduld“ gegenübergestellt werden. Es reflektiert bereits die klassische Suche nach innerer Harmonie und Ausgleich.
Willkommen und Abschied (Johann Wolfgang von Goethe)
https://schnell-durchblicken.de/goethe-willkommen-und-abschied-zwei-fassungen-und-eine-pointe
- Entstehungszeit: Das Gedicht existiert in einer frühen Fassung von 1771 und einer Spätfassung von 1789. Die Spätfassung entstand nach Goethes Italienreise (1786), die den Beginn der Weimarer Klassik markiert.
- Verortung im Übergang: Die Existenz einer frühen (Sturm und Drang) und einer späteren (klassisch beeinflussten) Fassung macht es zu einem idealen Beispiel für den Übergang, da Goethes eigene Entwicklung sichtbar wird.
- Elemente des Sturm und Drang (insbesondere in der Frühfassung):
◦ Ungebändigte Emotion und Naturerleben: Die Frühfassung ist bekannt für ihre intensive Darstellung der leidenschaftlichen Liebe und des Naturerlebens, das die inneren Gefühle des lyrischen Ichs widerspiegelt. Der „Geniegedanke“ mit dem sich selbst verwirklichenden Individuum ist hier stark spürbar.
◦ Kraftvolle Sprache und freie Rhythmen: Die Sprache ist oft exklamativ und bildreich, mit Elementen der „eigenen Jugendsprache mit kraftvollen Ausdrücken, Ausrufen, Halbsätzen“. Es gab oft eine Tendenz zu „freien Rhythmen“ und „kein Reim“.
- Elemente der Klassik (insbesondere in der Spätfassung):
◦ Formale Glättung und Verfeinerung: Die Überarbeitung von 1789 führte zu einer formalen Straffung, einer Glättung der Sprache und einer stärkeren Betonung von Rhythmus und Reim. Die Dichter der Klassik „blieb[en] den sich selbst gesetzten Regeln treu“.
◦ Distanzierung und Reflexion: Obwohl die Leidenschaft erhalten bleibt, ist in der späteren Fassung eine Tendenz zu größerer innerer Distanz und Reflexion erkennbar, die dem klassischen Streben nach Humanität und ästhetischer Vollkommenheit entspricht.
- Anteile: Die Frühfassung ist dominant stürmerisch. Die Spätfassung hingegen behält die emotionale Tiefe des Sturm und Drang bei, umschließt diese aber mit der formalen und sprachlichen Eleganz und Disziplin der Klassik. Dies zeigt den Versuch, Gefühl und Vernunft in Einklang zu bringen.
Neue Liebe, neues Leben (Johann Wolfgang von Goethe)
https://textaussage.de/goethe-neue-liebe-neues-leben-mp3-interpretation
- Entstehungszeit: Dieses Gedicht wird im Kontext des Vergleichs von Sturm und Drang, Klassik und Romantik behandelt, was auf seine Relevanz für die Übergangsphase hindeutet. Es ist eines von Goethes Liebesgedichten.
- Elemente des Sturm und Drang:
◦ Stürmische Gefühlswelt: Die direkten, fast verzweifelten Fragen an das eigene Herz („Herz, mein Herz, was soll das geben? Was bedränget dich so sehr?“) und die Ausrufe („Ach, wie kamst du nur dazu!“, „Liebe! Liebe! Lass mich los!“) sind typisch für die intensive Emotion und subjektive Ausdrucksweise des Sturm und Drang. Das Gefühl, von einer externen Macht (Liebe) überwältigt und gegen den eigenen Willen festgehalten zu werden, unterstreicht die Überordnung des Gefühls über den Verstand.
◦ Innerer Konflikt und Drang nach Freiheit: Der Wunsch, sich der Liebe zu entziehen („Will ich rasch mich ihr entziehen, Mich ermannen, ihr entfliehen“), spiegelt den stürmerischen Drang nach Freiheit von allen äußeren und inneren Zwängen wider.
- Elemente der Klassik:
◦ Formale Struktur: Das Gedicht ist in klar gegliederten Strophen (drei Strophen mit je acht Versen) und einem relativ regelmäßigen Reimschema verfasst (z.B. AABBCCDD in den ersten beiden Strophen des Auszugs). Diese Strophenform und Reimbindung weisen auf eine beginnende formale Disziplinierung hin, die über die ganz „freien Formen“ des Sturm und Drang hinausgeht und auf klassische Regelmäßigkeit zusteuert.
- Anteile: Das Gedicht ist inhaltlich stark im Sturm und Drang verankert, mit überwältigenden Emotionen und innerem Kampf. Die formale Gestaltung zeigt jedoch bereits Tendenzen zur klassischen Ordnung und Struktur, wodurch die intensiven Gefühle in einen geordneteren Rahmen gebracht werden.
Der Zauberlehrling (Johann Wolfgang von Goethe)
https://textaussage.de/ballade-zauberlehrling-von-vielen-details-zur-knappen-inhaltsangabe
Interessant das Gegengedicht, das sich mit einer zu starken Konzentration auf den Vorrang des „Meisters“ auflehnt.
https://textaussage.de/wie-schreibt-man-ein-gegengedicht-zu-goethes-ballade-der-zauberlehrling
- Entstehungszeit: 1797. Dies ist mitten in der Hochphase der Weimarer Klassik (1786-1832).
- Verortung im Übergang: Obwohl formal der Klassik zugeordnet, wird es thematisch als eine kritische Auseinandersetzung mit dem Sturm und Drang interpretiert, wodurch es die Übergangsthematik aufgreift.
- Elemente des Sturm und Drang (die kritisiert werden):
◦ Ungebändigter Geniegedanke: Der Zauberlehrling handelt aus „Drang zur Selbstverwirklichung in Kombination mit seinem Wissen“. Dieser ungezügelte Wille zur Schöpfung und die Überschätzung der eigenen Fähigkeiten ohne Rücksicht auf Konsequenzen („genialer Schöpfer selbstverwirklicht“) kann als Kritik am „Geniegedanken“ des Sturm und Drang verstanden werden, der „gegen die Wirklichkeit und Gesellschaft bzw. die Gesellschaftsnormen kämpft“. Das Scheitern des Lehrlings spiegelt das oft tragische Scheitern des Genies des Sturm und Drang wider, das an der Realität zerbricht.
- Elemente der Klassik (als Lösung angeboten):
◦ Harmonie, Ordnung und Autorität: Die Lösung des Problems erfolgt durch die „Anerkennung der Autorität des Hexenmeisters“, die „alles wieder ins Lot bringt“. Dies steht im Einklang mit den klassischen Idealen von „Gerechtigkeit, Toleranz, Gewaltlosigkeit und Harmonie“ sowie dem Streben nach „Ausgleich und Harmonie“ durch „Gesetzmäßigkeit“.
◦ Formale Perfektion (Ballade): Das Gedicht ist eine Ballade mit „ästhetische und harmonische Formen“ und einem „festes Versmaß“, was typisch für die Klassik ist und im Kontrast zu den freieren Formen des Sturm und Drang steht.
- Anteile: „Der Zauberlehrling“ ist formal und in seinen Botschaften rein klassisch, jedoch ist seine Thematik eine direkte Reflexion und Kritik an den potenziell gefährlichen Exzessen des Sturm und Drang. Es zeigt, wie die Klassik versuchte, die starken Gefühle und den Freiheitsdrang des Sturm und Drang zu kanalisieren und in einen harmonischen, vernunftgeleiteten Rahmen zu überführen.
Und jetzt noch einige Schiller-Gedichte
- Der Spaziergang (1795):
Etwas lang, wir kümmern uns noch drum 😉
https://www.friedrich-schiller-archiv.de/gedichte-schillers/highlights/der-spaziergang/
Von uns ausgewertet im Hinblick auf die Epochen
https://schnell-durchblicken.de/friedrich-schiller-der-spaziergang-ein-gedicht-der-klassik-mit-verbindungen-zum-sturm-und-drang
Das Gedicht beginnt mit einer fast romantischen Naturbeschreibung, die an den Sturm und Drang erinnert, entwickelt sich aber zu einer philosophischen Betrachtung über die Zivilisation und die Entwicklung der Menschheit. Hier verbinden sich der subjektive Blick auf die Natur mit einem klaren, klassizistischen Gedankengang.
— - Die Götter Griechenlands (1788):
auch sehr lang – wir kümmern uns drum 😉
https://www.friedrich-schiller-archiv.de/gedichte-schillers/highlights/die-goetter-griechenlands/
Dieses Werk, das sich sehnsüchtig der mythischen Welt der griechischen Antike zuwendet, zeigt bereits das klassizistische Interesse an der Antike und dem Ideal der menschlichen Vollkommenheit. Gleichzeitig schwingt die stürmerische Melancholie und der Weltschmerz mit, die für die Sturm und Drang-Bewegung typisch sind, da der Dichter das Schwinden dieser idealen Welt beklagt.
— - Das Lied von der Glocke (1799):
Wir sagten es schon – wir kümmern uns drum 😉
https://www.friedrich-schiller-archiv.de/inhaltsangaben/das-lied-von-der-glocke-zusammenfassung-friedrich-schiller/
Obwohl als Hauptwerk der Klassik angesehen, vereint es doch eine stürmische Dynamik und Lebenskraft in den Schilderungen des menschlichen Daseins mit dem klassischen Ideal von Harmonie und Gemeinschaft, das durch den Prozess des Glockengießens symbolisiert wird.
Schiller – auch romantisch?
- Wir haben eben noch Gedichte gefunden, die Schiller auch in die Nähe der Romantik ziehen.
Wir werden darauf noch genauer eingehen, aber hier schon mal die Links
Weitere Infos, Tipps und Materialien
- Themenseite:
https://schnell-durchblicken.de/die-weimarer-klassik-infos-tipps-und-materialien-themenseite
— - Die interessantes Gedichte aus der Epoche der Klassik
https://schnell-durchblicken.de/klausurvorbereitung-die-wichtigsten-gedichte-der-epoche-der-klassik - Infos, Tipps und Materialien zur deutschen Literaturgeschichte
https://textaussage.de/deutsche-literaturgeschichte-themenseite
—
- Themenseite Gedichtinterpretation Gedichte
https://textaussage.de/themenseite-gedichte-interpretieren
— - Infos, Tipps und Materialien zu weiteren Themen des Deutschunterrichts
https://textaussage.de/weitere-infos